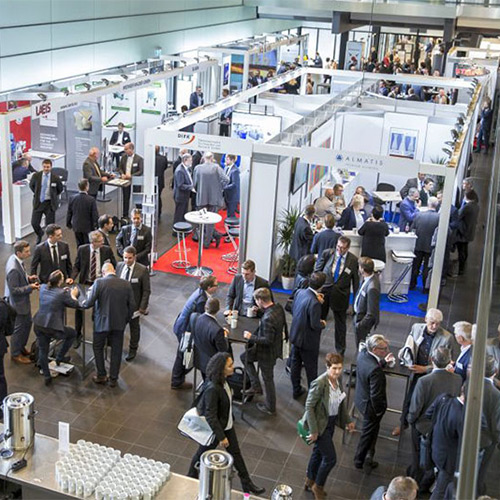Investitionen
Die Baustoff Steine-Erden-Industrie produziert aufgrund ihrer aufwendigen Abbau-, Aufbereitungs- und Brennprozesse kapital - intensiv. Entsprechend ist die Investitionstätigkeit im Vergleich zu anderen Branchen hoch.
Die Investitionsquote (= Investitionen/Umsatz) lag 2018 bei 6,2% und damit deutlich über dem Durchschnitt des Produzierenden Gewerbes (3,5%). Insgesamt wurden 2018 rund 1,68 Mrd. Euro in Maschinen, Grundstücke und Bauten investiert; dies entspricht einem Zuwachs von 12,6% gegenüber dem Vorjahr, wobei sich hier die gute Nachfragelage im Jahr 2018 widerspiegelt. Auch 2019 dürften die Investitionen gestiegen sein.
Angesichts der volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist damit zu rechnen, dass die Investitionstätigkeit der Branche – wie in der Wirtschaft insgesamt – 2020 deutlich zurückgehen wird. Die Baustoff Steine-Erden-Industrie weist je nach Subsektor recht heterogene Investitionsquoten auf.
Bedeutung für die Branche
Sie lagen 2018 zwischen knapp 3% und knapp 13%. Mehr als 17% der 2018 von der Gesamtbranche getätigten Investitionen entfielen auf Grundstücke und Bauten; im Produzierenden Gewerbe insgesamt liegt der Anteil mit rund 13% deutlich niedriger.
Dabei spiegelt sich die hohe Bedeutung der Rohstoffgewinnung in einigen Einzelbranchen wider, für die die Sicherung von Abbaugrundstücken eine zentrale Rolle spielt. So ist der auf Grundstücke/Bauten entfallende Anteil an den Investitionen in den weiterverarbeitenden Branchen tendenziell niedriger als in den rohstoffgewinnenden Bereichen, wie z. B. bei der Kies-, Sand-, Ton- und Kaolingewinnung (Anteil Grundstücke/Bauten an den Investitionen: gut 30%).
Investitionen für die Klimawende
Mit den Herausforderungen zur Bewältigung einer Klimawende und den damit einhergehenden Maßnahmen zum Umweltschutz steht die CO2-Reduzierung im Zentrum. Art und Menge im derzeitigen Energiemix muss sich entsprechend des EU Green Deals „Fit-for-55“ deutlich verändern.
Dafür sind nicht nur hohe Investitionen in die Prozesstechnologie und Ausstattung der Unternehmen erforderlich. Eine große Veränderung wird die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf z. B. Wasserstoff sein, der Mangels Verfügbarkeit und Leitungsinfrastruktur die Unternehmen (noch) nicht erreicht hat.
Ausbildung
Die Zahl der Auszubildenden in der Baustoff-Steine-Erden Industrie hat sich seit dem Jahr 2016 nicht merklich verändert und schwankt um die 5.300 Personen.
Der Anteil der Frauen an den Auszubildenden in der Gesamtbranche liegt bei 20% und ist damit höher als bei den Beschäftigten insgesamt. Alles in allem schwankt der Frauenanteil an den Auszubildenden in den Einzelbranchen zwischen 15 und 26%.
Der Anteil der ab 55-Jährigen an der Gesamtbranche beträgt über 25%. Damit liegt der Anteil derer, die in den nächsten Jahren altersbedingt aus dem Erwerbsleben ausscheiden, deutlich über dem der jüngeren Beschäftigten.
Hier bieten sich also große Chancen für eine qualifizierte Ausbildung in einem mittelständischen Unternehmen und die Möglichkeit, durch Engagement, Aus- und Weiterbildungen besondere Führungsaufgaben zu übernehmen.
Integrierte Ausbildungsprogramme und Weiterbildung im Berufsleben
Dieses integrierte Ausbildungssystem für Feuerfest (Integrated Refractory Education System „IRES“) ist inzwischen etabliert und begleitet die Entwicklung junger Menschen nach der Schule auf jeder Ebene der beruflichen Bildung und Qualifikation von der Ausbildung (Berufsbildende Schule in Montabaur) bis zur Promotion (Universität Koblenz-Landau in Koblenz). In Höhr-Grenzhausen wird ergänzend die Qualifikation zum staatlich geprüften Keramiktechniker an der Fachschule für Keramik und die akademische Bildung zum Bachelor of Engineering in der Fachrichtung Werkstofftechnik Glas/Keramik an der Hochschule Koblenz angeboten.
In der Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Koblenz und derUniversität Koblenz-Landau wird der gemeinsame Master-Studiengang Master of Ceramic Science and Engineering angeboten, in den jede der beiden Einrichtungen ihre Erfahrungen und Schwerpunkte der Feuerfest-Lehre einbringt.
Feuerfest-Campus
Durch diese enge Zusammenarbeit in Höhr-Grenzhausen mit den benachbarten Instituten des Bildungs- und Forschungszentrums Keramik e. V. (BFZK) wird das Wissen über feuerfeste Produkte, und deren Herstellung und Anwendung von der Berufsschule über die Techniker - und Ingenieursausbildung bis hin zur Hochschulpromotion gefördert.
Darüber hinaus
Über diese Ausbildungswege hinaus bietet das Europäische Feuerfest-Zentrum (ECREF) auch die Weiterbildung der Mitarbeiter aus der Feuerfest-Industrie, ihrer Zulieferer und ihrer Kunden an. So gilt das Internationale Feuerfest-Kolloquium (International Colloquium on Refractories, ICR®) in Europa mit 400 bis 500 Teilnehmern als jährliche Leitveranstaltung.
In Kooperation mit dem europäischen Feuerfest-Verband PRE findet zudem regelmäßig die dreitägige Seminarreihe „Refractories – Key Technology and its Applications“ zu den Schlüsseltechnologien und neuen Feuerfest-Anwendungen statt.
Wechselnde Industriethemen wie Prozesstechnik oder spezifische Materialkunde sowie Ausstellungsbereiche für die Zulieferindustrie ergänzen in diesem Rahmen das Seminarangebot und führen zu einer kontinuierlichen wissenschaftlichen Weiterbildung für nationale und internationale Gäste.
Nach 2015 lädt die deutsche Feuerfest-Industrie im September 2023 wieder zum Weltkongress UNITECR ein. Bei dieser Veranstaltung mit etwa 1.000 Teilnehmern werden künftige Entwicklungen von industriellem Wissen und Technologien in Bezug auf feuerfeste Materialien und deren Herstellungsverfahren aufgezeigt. Das Leitthema heißt:
„The Carbon Challenge - Steps and leaps to master the future"
Ohne Feuerfest geht nix
Das Wissen über feuerfeste Keramik zählt zu den strategischen Schlüsselelementen. Feuerfeste Werkstoffe sind unverzichtbar bei allen industriellen Hochtemperaturprozessen z. B. für die Herstellung von Stahl, Aluminium, Kupfer, Glas, Keramik oder Zement sowie in der chemischen Industrie und der Umwelttechnologie.
Mit feuerfesten Produkten können Produktionsprozesse auch über 2.000 Grad durchgeführt werden. Konventionelle industrielle Prozesse enden hinsichtlich der Hochtemperaturbeanspruchung bereits bei etwa 1.200 Grad.
Die Produkte sorgen für effizientere Herstellungsprozesse im Hochtemperaturbereich – sonst gäbe es z. B. kein Glas, es ginge nichts mehr bei der Stahlerzeugung oder in der chemischen Industrie. Es gäbe Probleme von der Umwelttechnologie über die Herstellung von Windrädern für die Energiewende bis hin zur Verbrennung von infektiösen Klinikabfällen.
Die deutsche Feuerfest-Branche ist die umsatzstärkste Region in Europa. Mit einer Wirtschaftskraft von über 1 Mrd. € Umsatz im Jahr und über 6.300 Beschäftigten (im Jahr 2020) in überwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen ist sie eine der wichtigsten in der Welt und führend bei Produktlösungen und Fertigungstechnologien.
Die Unternehmen stellen nicht nur keramische Bauteile und Werkstoffe her, sie organisieren zudem eine nachhaltige Rohstoffwirtschaft, schaffen Arbeitsplätze und sorgen durch eine einzigartige Kräftebündelung im Westerwald für alle relevanten Ausbildungswege, die in diesem Wirtschaftszweig und darüber hinaus erforderlich sind.
Kräftebündelung im Westerwald und Bildungsangebote für die ganze Welt
Der Wirtschaftsverband der deutschen Feuerfest-Industrie bündelt und verknüpft die Interessen der deutschen Hersteller auch hinsichtlich einer fachlichen Aus- und Weiterbildung. Am Verbandssitz in Höhr-Grenzhausen werden in einer Verbändekooperation das Wissen und die Erfahrung vieler Jahrzehnte an die nächsten Generationen weitergegeben. In der Forschungsgemeinschaft Feuerfest werden neue Anwendungsmöglichkeiten erschlossen, im Deutschen Institut für Feuerfest und Keramik werden weltweit die Qualität der eingesetzten Rohstoffe und der feuerfesten Werkstoffe nach internationalen Standards und Normen geprüft.
Im „European Centre for Refractories“ (ECREF), dem Europäischen Feuerfest-Zentrum, wird dieser einzigartige Zusammenschluss der Verbände auch räumlich in einer Bürogemeinschaft im eigens errichteten ECREF-Gebäude gebündelt. Hier wird aus dem Wissen bereits erfolgter Entwicklungen, der Prüfung aktueller Werkstoffe und der Forschung zu neuen innovativen Produktionsverfahren die Zukunft der Branche mitgestaltet. Mit diesem hohen Maß an Kompetenz und einem ausgeprägten und gelebten Netzwerk zu anderen Bildungsträgern werden von der ECREF regelmäßig spezifische Veranstaltungen, Seminare oder Kongresse angeboten.
Kostenstruktur
Die betriebswirtschaftliche Kostenstruktur in den Unternehmen der Steine-Erden-Industrie gestaltet sich je nach Branche sehr unterschiedlich, wobei alles in allem die Kosten für Materialeinsatz, Personal und Energie die höchsten Anteile haben. Dabei unterscheiden sich die Bereiche Rohstoffgewinnung und Produktion naturgemäß voneinander.
Während die Subsektoren, in denen die eigene Rohstoffgewinnung eine wesentliche Rolle spielt (Naturstein, Kies, Sand, Ton, Kaolin, Zement, Kalk, gebrannter Gips, Ziegel), durchschnittlich gut 17% des Bruttoproduktionswertes (BPW) für Material aufwenden, liegt der Durchschnitt über die übrigen Branchen bei mehr als 35%. Allerdings ist der Materialkostenanteil im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt mit durchschnittlich 41,7% (bezogen auf den BPW) noch deutlich höher.
Variable Kosten der Branche
Bezogen auf den Personalkostenanteil am BPW liegen alle Branchen über dem Niveau des Verarbeitenden Gewerbes insgesamt (18,4%). Die Kosten schwanken zwischen 16,0% bei der Herstellung von Transportbeton und 34,7% bei der Be- und Verarbeitung von Naturwerkstein. Die Kosten des Energieverbrauchs in der Steine-Erden-Industrie variieren sehr stark, da nur in einem Teil der Subsektoren energieintensive Prozesse wie Brechen, Mahlen und Brennen dominieren. Der Energiekostenanteil reicht von 2,1% bei der Herstellung von Mörtel bis zu 12,3% bei der Herstellung von Zement.
Insgesamt liegen alle Einzelbranchen der Baustoff Steine-Erden-Industrie über den durchschnittlichen Energiekosten des Verarbeitenden Gewerbes (1,6% des BPW).